Wie viel Boden steckt im Gebäude?
Die Judikatur des Bundesfinanzgerichts zwischen Pauschale und Nachweis.
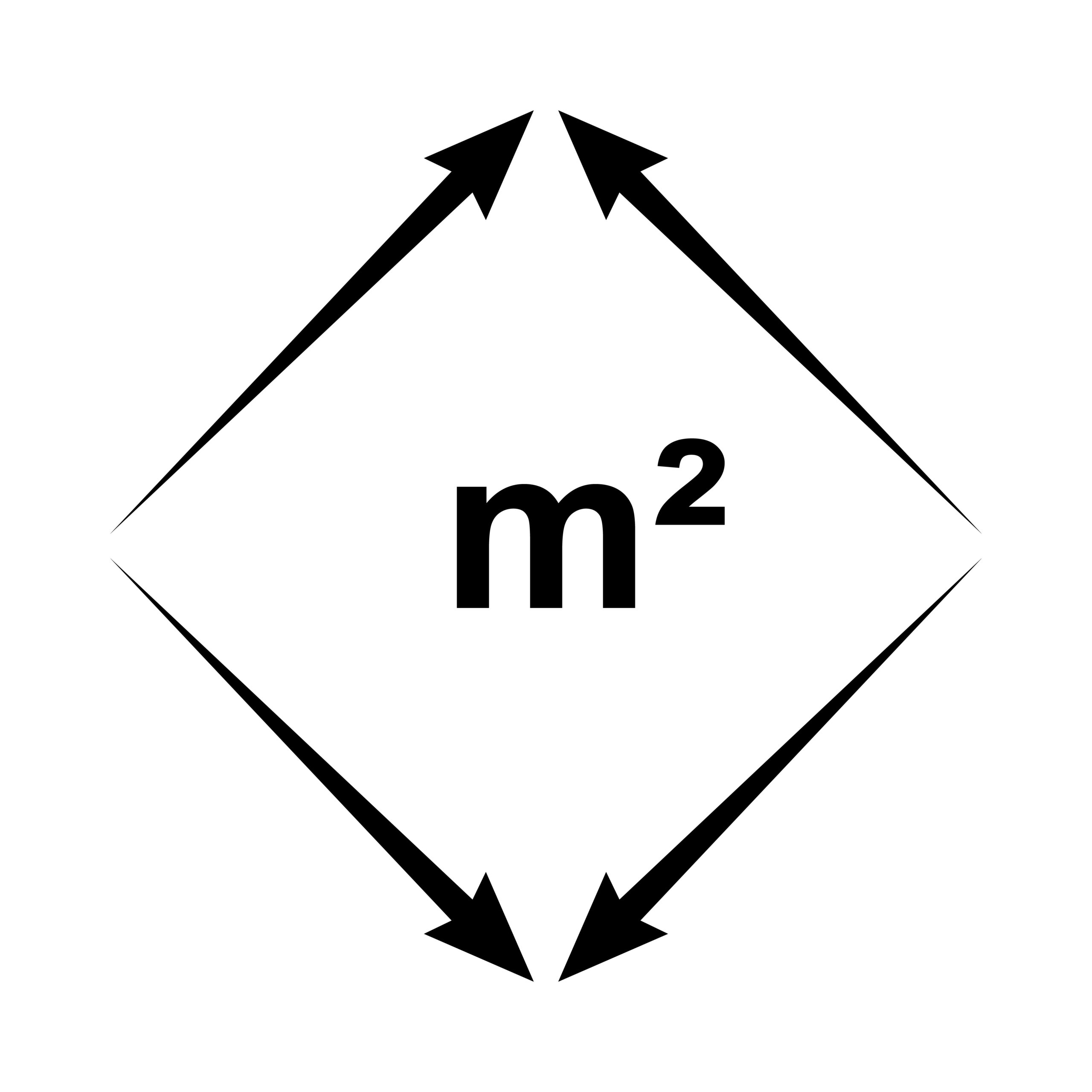
Die Frage, wie hoch der Anteil des Grund und Bodens bei der Anschaffung im Rahmen der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung vermieteter Immobilien anzusetzen ist, ist für die steuerliche Bemessung der Absetzung für Abnutzung (AfA) von erheblicher Bedeutung. Grund und Boden wird steuerlich als nicht abnutzbar gesehen, sodass nur die Anschaffungskosten für das Gebäude als Bemessungsgrundlage für die AfA verbleiben. Wie aber ist der Grund- und Boden-Anteil zu ermitteln?
Die Grundanteilsverordnung 2016 (BGBl II 99/2016) konkretisiert die gesetzliche Vorgabe des § 16 Abs 1 Z 8 lit d EStG 1988, in dem grundsätzlich 40 Prozent vorgesehen sind. Sie sieht pauschale Aufteilungsverhältnisse vor, die sich nach der Einwohnerzahl der Gemeinde, dem durchschnittlichen Quadratmeterpreis für baureifes Land und der Anzahl der Einheiten im Gebäude richten. In Gemeinden mit weniger als 100.000 Einwohnern und einem durchschnittlichen Baulandpreis von unter 400 Euro pro Quadratmeter beträgt der pauschale Grundanteil 20 Prozent. Liegt der Preis über dieser Schwelle bzw. gibt es mehr als 100.000 Einwohner, steigt der Anteil auf 30 bzw. 40 Prozent; abhängig von der Anzahl der Einheiten (mehr oder weniger als zehn). Die Verordnung enthält jedoch auch eine Öffnungsklausel. Weichen die tatsächlichen Verhältnisse offenkundig erheblich, d. h. zu mindestens 50 Prozent vom pauschalen Wert ab, kann ein abweichender Wert angesetzt werden. Die Beweislast liegt dabei beim Steuerpflichtigen.
Die Judikatur des BFG
Zwei Entscheidungen des Bundesfinanzgerichts (BFG) zeigen, wie unterschiedlich diese Regelung in der Praxis ausgelegt werden kann. Im Fall RV/1100116/2019 24. Juni 2025 ging es um eine Wohnung in einer Gemeinde mit weniger als 100.000 Einwohnern, aber einem durchschnittlichen Baulandpreis von über 400 Euro pro Quadratmeter. Der Steuerpflichtige setzte den Grundanteil mit 9 Prozent an, wobei er sich auf den Immobilienpreisspiegel der Zeitschrift „Gewinn“ stützte. Das Finanzamt hingegen wandte den pauschalen Satz von 30 Prozent an. Das BFG bestätigte die Sichtweise der Behörde, wonach die vorgelegten Unterlagen nicht geeignet waren, eine offenkundige erhebliche Abweichung glaubhaft zu machen. Insbesondere fehlte ein Sachverständigengutachten, das den tatsächlichen Verkehrswert des Grund und Bodens belegen konnte. Die dargebrachten Immobilienpreisspiegel bilden zwar gewisse Marktpreise ab, diese sind aber nicht konkret auf das gegenständliche Objekt bezogen. Die Beschwerde wurde daher abgewiesen, eine Revision nicht zugelassen.
Anders entschied das BFG im Fall RV/5100286/2023 vom 11. Juni 2024. Auch hier befand sich die Wohnung in einer Gemeinde mit weniger als 100.000 Einwohnern. Allerdings lag der durchschnittliche Baulandpreis unter 400 pro Quadratmeter, sodass der pauschale Grundanteil 20 Prozent betrug. Der Beschwerdeführer legte eine detaillierte Berechnung der Bauträgergesellschaft vor, aus der sich ein Grundanteil von rund 7 Prozent ergab. Zusätzlich wurden Kaufverträge, Grundbuchauszüge und Vergleichswerte aus der Umgebung vorgelegt. Das BFG erkannte eine offenkundige erhebliche Abweichung vom pauschalen Wert an und qualifizierte die Unterlagen als hinreichend konkret und objektbezogen. Der Grundanteil wurde daher auf 10 Prozent reduziert. Die Richter betonten, dass die Abweichung bereits durch einfache Abfragen und Preisvergleiche erkennbar gewesen sei. Die Revision wurde in diesem Fall zugelassen, da es an einer gefestigten Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs zu dieser Frage fehle (wurde aber soweit ersichtlich nicht erhoben).
Die beiden Entscheidungen zeigen deutlich, dass die Grundanteilsverordnung zwar eine starke Vermutungswirkung entfaltet, aber nicht unangreifbar ist. Entscheidend ist die Qualität und Nachvollziehbarkeit der vorgelegten Nachweise.



